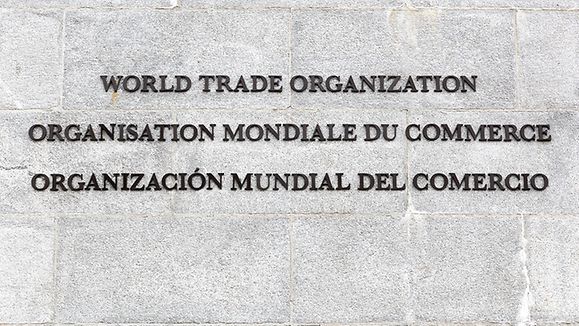Letzte Aktualisierung: 28.08.2023
Das GATT gilt als Gründungselement des internationalen Warenhandels und steht für den Abbau von Handelsbarrieren.
Das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) gilt als das zentrale von der WTO administrierte Abkommen.
Entstehung und Entwicklung des GATT
Im Jahre 1944 fand mit 44 Staaten die Bretton-Woods-Konferenz in den USA statt, mit der die Gründung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank einherging. Das ursprüngliche Ziel der Konferenz, neben dem IWF und der Weltbank ebenfalls eine Welthandelsorganisation (ITO/International Trade Organization) zu gründen, ließ sich dagegen aufgrund einer fehlenden Einigung nicht realisieren. Stattdessen wurde ein Vertragstext, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen von 1947 (GATT), aufgesetzt, welches sodann am 30. Oktober 1947 abgeschlossen wurde und am 1. Januar 1948 in Kraft trat.
Der völkerrechtliche Vertrag zählte damals 23 Gründungsmitglieder (Australien, Belgien, Brasilien, Burma, Kanada, Ceylon, Chile, China, Kuba, Frankreich, Indien, Libanon, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Südrhodesien, Südafrikanische Union, Syrien, Tschechoslowakei, Vereinigtes Königreich sowie USA). Ende 1994 und somit kurz vor Inkrafttreten der WTO gehörten 128 Länder dem GATT an. Deutschland trat bereits am 1. Oktober 1951 bei.
Die Grundprinzipien im GATT
Das GATT strebt die Beseitigung von Handelshemmnissen an, um folglich den internationalen Warenverkehr zu fördern. Dabei steht die Ware im Mittelpunkt des Handels, die durch das Prinzip der Meistbegünstigung und der Inländerbehandlung einer Diskriminierung vorenthalten bleiben soll.
Nach dem Prinzip der Meistbegünstigung (Art. I GATT) müssen Vorteile, die einem Mitglied gewährt werden, auch anderen WTO-Mitgliedern gewährt werden. Die Inländergleichbehandlung strebt dagegen eine Gleichstellung inländischer und ausländischer Waren an.
Neben dem Diskriminierungsverbot verfolgt das GATT ebenfalls den Abbau von Handelshemmnissen, indem es gemäß Art. XI GATT mengenmäßige Beschränkungen verbietet und jedes WTO-Mitglied zur Zollbindung gemäß Art. II GATT verpflichtet. Ergänzt werden diese Prinzipien zudem um das Transparenzgebot.
Abbau von Handelsbarrieren als primäres Ziel
Das übergeordnete Ziel des Abkommens liegt im Abbau von Handelshemmnissen. Handelshemmnisse sind Maßnahmen, die den Außenhandel beeinträchtigen und diesen in ihrer Entwicklung behindern. Es werden die tarifären und die nichttarifären Handelshemmnisse unterschieden.
Tarifäre Maßnahmen
Tarifäre Hemmnisse, wie zum Beispiel Zölle, sind direkt wirkende protektionistische Maßnahmen, die den Außenhandel beschränken. Zumeist werden Zölle auf Importe erhoben, um somit die importierte Ware des Auslandes um den jeweiligen Zollsatz zu erhöhen und folglich die inländische Ware attraktiver zu gestalten.
Ob daneben auch Exportquoten und Mindestpreise zu den tarifären Hemmnissen gehören, ist strittig. Exportsubventionen sind Unterstützungsmaßnahmen des Staates, wenn Unternehmen aufgrund hoher Produktionskosten Schwierigkeiten haben, das Produkt im Ausland abzusetzen. Eine Subvention kann dabei nach Menge oder Wert bestimmt sein. Eine Maßnahme zur Erhaltung der Preisstabilität sind sogenannte Mindestpreise für Waren, die nicht unterschritten, aber überschritten, werden dürfen.
Nichttarifäre Maßnahmen
Ähnlich wie Zölle zeigen auch nichttarifäre Hemmnisse marktverzerrende Wirkungen. Nichttarifäre Maßnahmen sind dabei indirekt protektionistisch wirkende Maßnahmen. Welche Maßnahmen darunter fallen, ist nicht ganz klar. Beispielsweise gliedert die WTO die nichttarifären Maßnahmen in drei Kategorien, die OECD dagegen in zwei Kategorien.
Wie lassen sich nichttarifäre Maßnahmen klassifizieren?| Gliederung der WTO | Gliederung der OECD |
|---|
Einfuhr betreffende Maßnahmen: Zum Beispiel Einfuhrverbote oder -lizenzen | Technische Maßnahmen: Zum Beispiel Standards, Zertifizierungen |
Ausfuhr betreffende Maßnahmen: Zum Beispiel Ausfuhrverbote | Nichttechnische Maßnahmen: Zum Beispiel mengenmäßige Beschränkungen |
"Maßnahmen hinter der Grenze": Zum Beispiel Gesundheits-, Technik- und Umweltnormen | |
Quelle: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201201_e.pdf; https://www.oecd.org/trade/topics/non-tariff-measures/
Das GATT spricht sich für ein Verbot solcher nichttarifären Handelshemmnisse aus. Ausnahmen, die dennoch nichttarifäre Handelshemmnisse zulassen, sind im GATT niedergeschrieben. Vorausgesetzt wird hierbei, dass das nichttarifäre Hemmnis notwendig, nicht-diskriminierend und angemessen ist. Weitere Informationen zu den Handelshemmnissen.
Schritt für Schritt zum Abbau von Hemmnissen: Die Zollsenkungsrunden
Innerhalb der ersten fünf Zollsenkungsrunden (1947 bis 1962) konnten Zollzugeständnisse in Form von Zollsenkungen oder -bindungen erzielt werden. In den 50er- und 60er-Jahren führte dies zu einem Wachstum des Welthandels um rund acht Prozent pro Jahr. Das steigende Handelswachstum, ausgelöst durch die Handelsliberalisierung, bewirkte eine nachhaltige Verbesserung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. In der sechsten und siebten Verhandlungsrunde wurden sodann nichttarifäre Handelshemmnisse mit einbezogen. Heute kann auf acht Verhandlungsrunden zurückgeblickt werden, die allesamt einem Abbau von Handelshemmnissen beigetragen haben.
WTO-Verhandlungsrunden im Überblick| Runde | Ort | Jahr | Zollabbau in % | Anzahl der teilnehmenden Staaten |
|---|
| 1. | Genf | 1947 | 19 | 23 |
| 2. | Annecy | 1949 | 2 | 13 |
| 3. | Torquay | 1950/1951 | 3 | 38 |
| 4. | Genf | 1955/1956 | 2 | 26 |
| 5. | Genf (Dillon) | 1961/1962 | 2 | 26 |
| 6. | Genf (Kennedy) | 1964-1967 | 35 | 62 |
| 7. | Genf (Tokio) | 1973-1979 | 34 | 102 |
| 8. | Uruguay | 1986-1994 | 40 | 117 |
| 9. | Katar (Doha) | 2001-2016 | gescheitert | 123 |
Quelle: Rübel, Außenwirtschaft: Grundlagen der realen und monetären Theorie, 2013, S. 229.
Vom GATT zur WTO
Das GATT 1947 nimmt aufgrund historischer Gegebenheiten eine zentrale Rolle des Welthandelsrechts ein und gilt heute als Gründungselement der WTO. Die elementare Grundlage des Welthandelsrechts ergibt sich aus dem GATT 1947, sodass die Grundsätze und Prinzipien ebenfalls im GATT und nicht separat im WTO-Übereinkommen wiederzufinden sind.
Das GATT 1947 erfuhr seit Inkrafttreten einige Änderungen, sodass heute von dem GATT 1994 zu sprechen ist. Das GATT 1994 enthält lediglich Ergänzungen zum GATT 1947, sodass die Kernelemente des Warenhandels noch immer im GATT 1947 vermerkt sind.
Mit der achten Runde (Uruguay-Runde) im Jahr 1994 in Marrakesch wurde deutlich, dass sich das GATT 1947 (mit Ergänzungen durch das GATT 1994) lediglich auf den Warenverkehr bezieht und dies nicht mehr zeitgemäß ist. Weitere Sektoren, wie die Landwirtschaft, die Textilindustrie oder auch der Dienstleistungssektor bedürfen ebenfalls Berücksichtigung im weltweiten Handel. Demnach wurde das GATT 1947 weiterentwickelt, um ein umfassendes Welthandelsrecht zu errichten. Das GATT gilt deshalb als Gründungselement der heutigen Welthandelsorganisation, die 1995 in Kraft trat. Das Übereinkommen zur Errichtung der WTO besteht heute aus drei elementaren Säulen und weiteren Nebenabkommen.
Von Dr. Melanie Hoffmann
|
Bonn