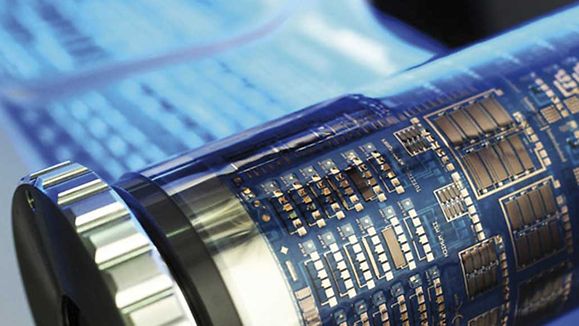Branchen I USA I Quantencomputing
Praktische Quantenberechnungen rücken in greifbare Nähe
IT-Unternehmen in den USA melden Durchbrüche. Dadurch könnte, was einst Jahrzehnte entfernt schien, schon bald Realität werden: der Bau leistungsstarker Quantencomputer.
24.04.2025
Von Heiko Stumpf | San Francisco
Amerikanische Tech-Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz – doch parallel zu dieser Entwicklung nimmt bereits der nächste Durchbruch Formen an. Microsoft und andere Firmen arbeiten mit Hochdruck daran, dass schon in wenigen Jahren praktische und nützliche Quantenberechnungen möglich sein sollen. "Gemeinsam mit unserem Partner Atom Computing wollen wir noch im Jahr 2025 einen Quantencomputer mit 50 logischen Qubits auf den Markt bringen", kündigte Krysta Svore, Technical Fellow bei Microsoft, auf der GTC-Konferenz im März 2025 im kalifornischen San José an.
Ein solcher Schritt wäre ein Meilenstein, denn bisherige Quantencomputer dienen vor allem experimentellen Zwecken. Mit 50 logischen Qubits wären Berechnungen möglich, die heutige Supercomputer an ihre Grenzen brächten. "Für die nächste Generation arbeiten wir bereits an Quantencomputern mit 100 logischen Qubits, womit auch klassische Methoden in der Wissenschaft übertroffen werden könnten", so Svore. Dies könnte neue Möglichkeiten in Bereichen wie der Arzneimittel- und Materialforschung eröffnen.
Bei Qubits zählt Qualität, nicht Quantität
Das Konzept der logischen Qubits ist wie die gesamte Quantentechnologie hochkomplex. Klassische Computer verarbeiten Informationen in Form von Bits, die nur zwei Zustände kennen – 0 oder 1. Quantencomputer arbeiten hingegen mit subatomaren Teilchen, sogenannten physikalischen Qubits, die nicht nur den Zustand 0 oder 1 annehmen, sondern auch gleichzeitig 0 und 1 repräsentieren können. Aufgrund dieser und weiterer quantenmechanischer Eigenschaften könnten Quantenprozessoren bei bestimmten Aufgaben eine exponentiell höhere Rechenleistung erreichen als bisherige Systeme.
Physikalische Qubits können auf verschiedene Weise erzeugt werden, etwa mit supraleitenden Schaltkreisen, Ionenfallen, neutralen Atomen, Quantenpunkten, Photonen oder Spins in Diamanten. Entscheidend ist dabei aber nicht die Anzahl, sondern die Zuverlässigkeit der Qubits. Denn Quanteninformationen sind sehr störanfällig, etwa durch Umwelteinflüsse wie Wärme, Strahlung oder Rauschen. Dies könnte leicht zu Fehlern in Berechnungen führen.
"Ein spannender Trend, der sich gerade abzeichnet, ist die wachsende Bedeutung der Quantenfehlerkorrektur", erklärte Simone Severini, General Manager für Quantum Technologies bei AWS, auf der GTC-Konferenz. Bei dieser Methode werden viele fehleranfällige physikalische Qubits zu einem stabilen logischen Qubit zusammengefasst. Für die von Microsoft geplanten 50 logischen Qubits werden deshalb über 1.000 physikalische Qubits benötigt.
Bei logischen Qubits geht es plötzlich schnell
Die Fähigkeit, logische Qubits in größerem Maßstab zu realisieren, gilt als zentrales Element für zuverlässige Quantencomputer – und genau in diesem Bereich ging es zuletzt Schlag auf Schlag.
Den Auftakt machte im Dezember 2024 Google mit dem neuen Quantenprozessor Willow, der erstmals in der Lage ist, Fehler in exponentieller Weise zu korrigieren. Je mehr Qubits der Willow-Chip verwendet, desto mehr Fehler können korrigiert werden. Bislang galt genau das Gegenteil: Mehr Qubits bedeuteten auch mehr Fehler. Mit Willow konnte Google eine Benchmark-Berechnung in weniger als fünf Minuten durchführen, für die der schnellste heutige Supercomputer zehn Septillionen Jahre benötigen würde; ein Zeitraum, der das Alter des Universums bei Weitem übersteigt.
Amazon folgte im Februar 2025 mit einem Prototyp des Quantenprozessors Ocelot. Er basiert auf sogenannten Cat-Qubits – eine spezielle Form von supraleitenden Qubits, die auf dem Prinzip von Schrödingers Katze beruhen. Diese Architektur ermöglicht eine effizientere Fehlerkorrektur und kann die Zahl benötigter physikalischer Qubits pro logischem Qubit um bis zu 90 Prozent reduzieren.
Quantencomputerstandort in Süddeutschland
Ebenfalls im Februar 2025 sorgte Microsoft mit dem Majorana-1-Prozessor in der Fachwelt für Aufsehen. Dieser nutzt topologische Qubits, die besonders fehlerresistent sind. In Zukunft könnte ein einzelner Majorana-Chip auf bis zu 1 Million Qubits skaliert werden – ein möglicher Durchbruch für leistungsfähige und fehlertolerante Quantencomputer.
Auch der Quantenponier IBM macht große Fortschritte. Der für 2029 angekündigte Quantum-Starling-Prozessor soll 200 logische Qubits enthalten. Ab 2033 plant IBM den Bau von Quantencomputern mit mehreren Tausend logischen Qubits. In Poughkeepsie, New York betreibt IBM das weltweit größte Quantenrechenzentrum. Im baden-württembergischen Ehningen eröffnete das Unternehmen im Oktober 2024 einen zweiten Standort für Quantencomputer.
Staatliche Förderung im Schwebezustand
Die Zukunft der nationalen Förderung der USA für Quantenforschung ist ungewiss. Zentrales Element ist die National Quantum Initiative (NQI). Das im Jahr 2018 aufgelegte Förderprogramm umfasste 1,3 Milliarden US-Dollar (US$) über fünf Jahre.
Nachdem die NQI aber im September 2023 ausgelaufen war, fehlt staatlichen Forschungseinrichtungen eine gesetzliche Grundlage für neue Förderzusagen – dies betrifft insbesondere Programme des National Institute of Standards and Technology (NIST), der National Science Foundation (NSF) und des Department of Energy (DOE).
Im US-Kongress wurde bereits ein Gesetzentwurf für den National Quantum Initiative Reauthorization Act eingebracht. Er sieht vor, über einen Zeitraum von fünf Jahren 2,7 Milliarden US$ zusätzlich für die Quantenforschung bereitzustellen. Im Februar 2025 wurde zudem der DOE Quantum Leadership Act vorgestellt, der speziell die Quantenforschung des Energieministeriums mit 2,5 Milliarden US$ fördern soll.
Solange die Gesetzentwürfe vom Kongress nicht verabschiedet sind, bleibt die tatsächliche Höhe der Förderung für die Quantenforschung offen. Andere Programme, insbesondere auf bundesstaatlicher Ebene, sind davon nicht betroffen.
Deutschland und die USA unterzeichneten am 22. Mai 2024 in Berlin eine gemeinsame Erklärung zur Forschungszusammenarbeit im Bereich Quantentechnologien.
Quantencomputer der Superlative soll in Chicago entstehen
Neben den großen Technologieunternehmen zeichnen sich die USA durch eine sehr aktive Start-up-Szene im Bereich Quantencomputing aus. Dazu zählen Unternehmen wie IonQ und Quantinuum für Ionenfallen, Rigetti und Quantum Circuits für supraleitende Qubits sowie QuEra und Atom Computing für neutrale Atome. PsiQuantum wiederum verfolgt einen photonikbasierten Ansatz.
Chips aus Dresden und Komponenten aus Mannheim für Illinois
In Chicago plant PsiQuantum bis 2028 den Bau eines Quantencomputers mit bis zu einer Million fehlertoleranter Qubits. Das Unternehmen fungiert dabei als Ankermieter des geplanten Illinois Quantum and Microelectronics Park (IQMP). PsiQuantum will selbst über 1 Milliarde US$ in das Projekt investieren. Der IQMP kann zusätzlich mit Fördermitteln in Höhe von rund 1,3 Milliarden US$ rechnen, die insbesondere vom Bundesstaat Illinois stammen.
Für das Vorhaben kooperiert PsiQuantum mit dem Hersteller von Halbleitern Global Foundries, welcher die für das Projekt benötigten Chips in New York und Dresden produzieren will. Zudem arbeitet PsiQuantum mit dem Mannheimer Unternehmen Extoll zusammen, das Komponenten und Chiplets liefert, um die Datenkommunikation innerhalb des photonischen Quantencomputers zu optimieren. Dies ist ein gutes Beispiel, wie deutsche Technologieunternehmen am Quantencomputerbau mitverdienen können.
Quantentechnologie trifft den Markt – Events bieten Chance zur Geschäftsanbahnung
IEEE Quantum Week: Fachkonferenz vom 31. August bis 5. September 2025 in Albuquerque, New Mexico
Q2B Silicon Valley: Fachkonferenz vom 9. bis 11. Dezember 2025 in Santa Clara, Kalifornien
SPIE Quantum West: Fachmesse vom 20. bis 22. Januar 2026 in San Francisco mit deutschem Gemeinschaftsstand